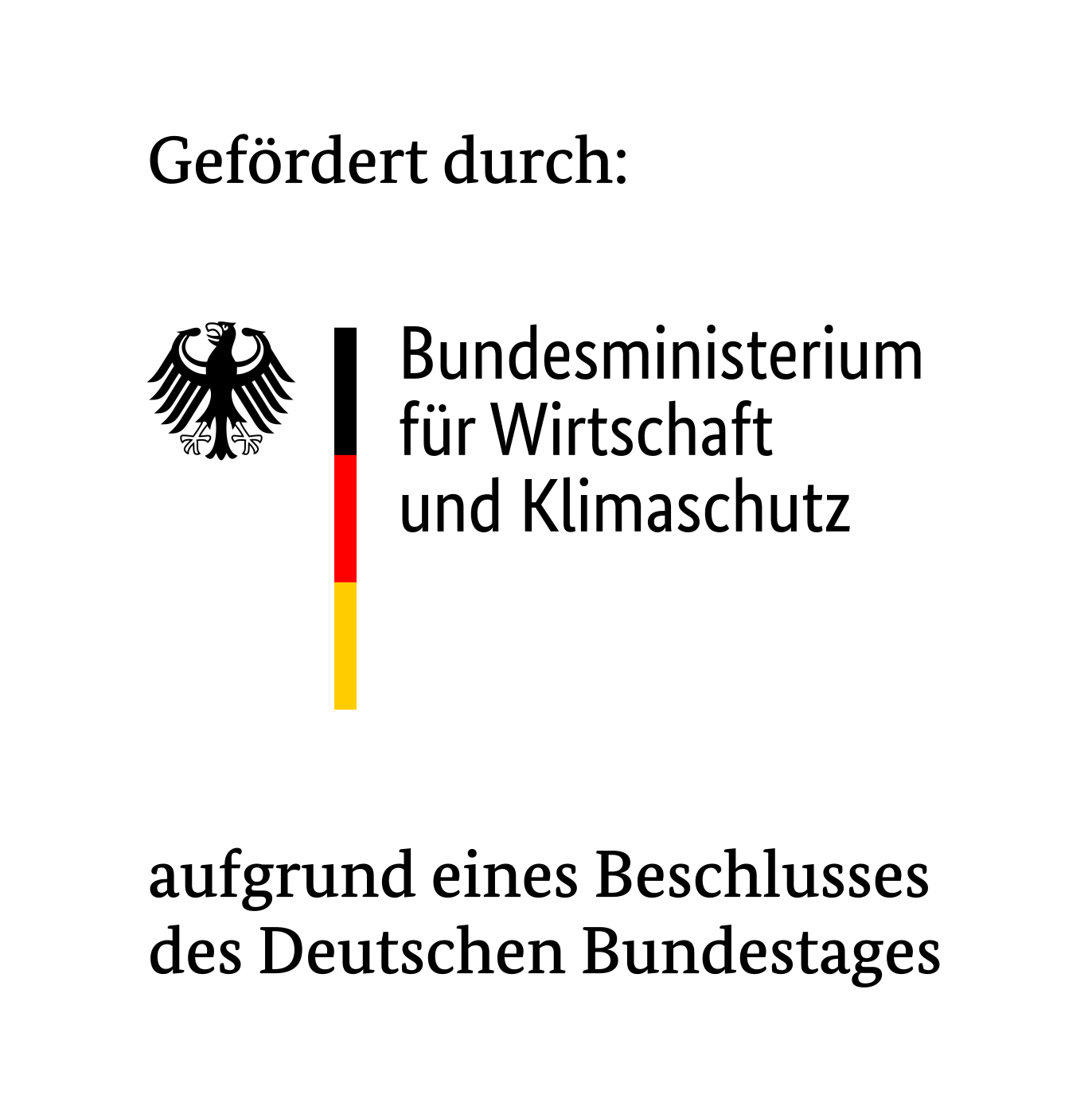Gebäudehülle
Geräte
Bei der Vor-Ort-Beratung im Unternehmen zum Thema Gebäudehülle sind die folgenden Messgeräte und Hilfsinstrumente hilfreich, um energetische Schwachstellen aufzuspüren und aufzuzeigen. So können z.B. mit der Thermographie-Kamera Wärmeverluste gefunden und sichtbar gemacht werden, die mit Auge nicht erkennbar sind. Das visuelle Demonstrieren von energetischen Schwachstellen sensibilisiert oder überzeugt oft den Unternehmer weitere Schritte zu tun, um den Energieverbrauch zu senken.
Um bei fehlenden Plänen die Raumfläche / das -volumen für die überschlägliche Abschätzung des Wärmebedarfs zu ermitteln, bietet sich ein Distanzmessgerät an.
Um bei fehlenden Plänen die Raumfläche / das -volumen für die überschlägliche Abschätzung des Wärmebedarfs zu ermitteln, bietet sich ein Distanzmessgerät an.
- Thermographie-Kamera:
- Infrarotthermometer: Messgerätekarte
- Laser-Entfernungsmesser:
- Datenlogger Wärme-Feuchte: Messgerätekarte
Energieeffiziente Gebäudehülle
Betriebsgebäude von Handwerksbetrieben lassen sich hinsichtlich der Gebäudehülle meist in mehrere Bereiche aufteilen. So sind neben der eigentlichen Werkstatt, Lagerräumen und Sonderräumen (z.B. Lackierbereich) oft Ausstellungsbereiche für den Verkauf vorhanden. Des Weiteren sind in Teilbereichen Büros, Sozialräume, WC und Sanitärbereiche untergebracht. Die Flächenanteile der einzelnen Betriebsbereiche schwanken, je nach Gewerk, Betriebsgröße und Betriebsschwerpunkten (Herstellung, Verkauf / Reparatur).
Die Werkstattbereiche sind meist geringer temperiert als die restlichen Betriebsbereiche und häufig in Leichtbauweise (Sandwichplatten, Trapezbleche, Gasbetonwände bzw. gemauerte Wände) mit hohen Raumhöhen errichtet. An den Wandflächen dominieren meist großflächige Tore und Fensterelemente mit hohen U-Werten, die große Wärmeverluste erzeugen. Bodenplatten sind in älteren Betriebsgebäuden vielfach ungedämmt und können auch nachträglich nicht mehr gedämmt werden. Sind Werkstattbereiche unterkellert, z.B. durch unbeheizte Lagerbereiche, stellt das Dämmen der Kellerdecke eine günstige und wirtschaftliche Maßnahme dar.
Neben den Transmissionswärmeverlusten durch die mehr oder weniger gut gedämmte Gebäudehülle entstehen im Werkstattbereich durch das häufige Öffnen der Tore große Lüftungswärmeverluste, die nach Schließen der Tore - je nach Heizsystem - wieder mühsam durch Raumerwärmung kompensiert werden müssen. Durch Undichtigkeit der Gebäudehülle in Dach-/Deckenbereichen kommen, verstärkt durch die thermische Schichtung der Luft in der Halle (oben warm-unten kalt), noch Lüftungswärmeverluste hinzu.
Wegen der hohen Flächenanteile der Bauteile sind energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle häufig kostenintensiv und benötigen lange Amortisationszeiten, steigern aber im Sommer wie im Winter deutlich die Behaglichkeit in der Werkstatt, verbessern die Beheizbarkeit der Halle und reduzieren die erforderliche Leistung eines Heizkessels. Bei einer integrierten Herangehensweise der Sanierung (Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Klimatisierung) sind bis zu 80 Prozent Energieeinsparung möglich.
Wer systematisch an die Energieeffizienz-Verbesserung herangehen will, sollte als ersten Schritt den Ist-Zustand analysieren. Dies umfasst sämtliche Teile des zu untersuchenden Gebäudes von der Wärmebereitstellung über die Außenwände inklusive der Fenster und Tore bis hin zur Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energieträger oder Kraft-Wärme-Kopplung. Liegen dann die Ergebnisse zum Beispiel in Form eines Energiesparkonzepts vor, kann mit der Entscheidung über geeignete wirtschaftliche Maßnahmen sowie deren Umsetzung begonnen werden.
Hier einige Energieeffizienzmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäudehülle, die aber wegen der gegenseitigen Beeinflussung nicht getrennt von den anderen Themen umgesetzt werden sollten.
Die Werkstattbereiche sind meist geringer temperiert als die restlichen Betriebsbereiche und häufig in Leichtbauweise (Sandwichplatten, Trapezbleche, Gasbetonwände bzw. gemauerte Wände) mit hohen Raumhöhen errichtet. An den Wandflächen dominieren meist großflächige Tore und Fensterelemente mit hohen U-Werten, die große Wärmeverluste erzeugen. Bodenplatten sind in älteren Betriebsgebäuden vielfach ungedämmt und können auch nachträglich nicht mehr gedämmt werden. Sind Werkstattbereiche unterkellert, z.B. durch unbeheizte Lagerbereiche, stellt das Dämmen der Kellerdecke eine günstige und wirtschaftliche Maßnahme dar.
Neben den Transmissionswärmeverlusten durch die mehr oder weniger gut gedämmte Gebäudehülle entstehen im Werkstattbereich durch das häufige Öffnen der Tore große Lüftungswärmeverluste, die nach Schließen der Tore - je nach Heizsystem - wieder mühsam durch Raumerwärmung kompensiert werden müssen. Durch Undichtigkeit der Gebäudehülle in Dach-/Deckenbereichen kommen, verstärkt durch die thermische Schichtung der Luft in der Halle (oben warm-unten kalt), noch Lüftungswärmeverluste hinzu.
Wegen der hohen Flächenanteile der Bauteile sind energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle häufig kostenintensiv und benötigen lange Amortisationszeiten, steigern aber im Sommer wie im Winter deutlich die Behaglichkeit in der Werkstatt, verbessern die Beheizbarkeit der Halle und reduzieren die erforderliche Leistung eines Heizkessels. Bei einer integrierten Herangehensweise der Sanierung (Gebäudehülle, Heizung, Lüftung, Klimatisierung) sind bis zu 80 Prozent Energieeinsparung möglich.
Wer systematisch an die Energieeffizienz-Verbesserung herangehen will, sollte als ersten Schritt den Ist-Zustand analysieren. Dies umfasst sämtliche Teile des zu untersuchenden Gebäudes von der Wärmebereitstellung über die Außenwände inklusive der Fenster und Tore bis hin zur Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energieträger oder Kraft-Wärme-Kopplung. Liegen dann die Ergebnisse zum Beispiel in Form eines Energiesparkonzepts vor, kann mit der Entscheidung über geeignete wirtschaftliche Maßnahmen sowie deren Umsetzung begonnen werden.
Hier einige Energieeffizienzmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäudehülle, die aber wegen der gegenseitigen Beeinflussung nicht getrennt von den anderen Themen umgesetzt werden sollten.

|
| Wärmeverluste des Gebäudes |
| Copyright: HWK-Münster |
Jeder Energieverlust kostet bares Geld, deshalb sollte die erzeugte Wärme auch möglichst vollständig im Gebäude genutzt werden.
Neben unzureichender Wärmedämmung der Gebäudehülle sind oft überalterte, zu große oder undichte Hallentore Grund für relativ hohe Wärmeverluste und Energiekosten. Dies bedeutet, nicht nur die Dämmung einer Halle zu planen, sondern auch die „Leckagen“ zu berücksichtigen. Denn was nützt eine gute Wärmedämmung, wenn die mit teurer Energie erwärmte Innenluft durch offen stehende Tore oder undichte Stellen in der Gebäudehülle entweichen und ständig kalte Außenluft in das Gebäude einströmen kann?
Neben baulichen/technischen Maßnahmen kann es oft auch sinnvoll sein, das Heiz-und Lüftungskonzept auf die betrieblichen Abläufe anzupassen.
Neben unzureichender Wärmedämmung der Gebäudehülle sind oft überalterte, zu große oder undichte Hallentore Grund für relativ hohe Wärmeverluste und Energiekosten. Dies bedeutet, nicht nur die Dämmung einer Halle zu planen, sondern auch die „Leckagen“ zu berücksichtigen. Denn was nützt eine gute Wärmedämmung, wenn die mit teurer Energie erwärmte Innenluft durch offen stehende Tore oder undichte Stellen in der Gebäudehülle entweichen und ständig kalte Außenluft in das Gebäude einströmen kann?
Neben baulichen/technischen Maßnahmen kann es oft auch sinnvoll sein, das Heiz-und Lüftungskonzept auf die betrieblichen Abläufe anzupassen.
Ausführung der Wärmedämmung prüfen
Große Wärmeverluste werden oft durch unzureichende Wärmedämmung verursacht. Der größte Verlust findet in der Regel über die Hallendecke statt. Deshalb sollte das erste Augenmerk auf die Decke und erst in zweiter Linie auf die Wände gerichtet werden. Die Anbringung einer nachträglichen Wärmedämmung sollte unter Beachtung baulicher Gegebenheiten geprüft werden. Grundsätzlich sind hierbei die gesetzlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten. Beispielsweise liegen typische Dämmstärken, je nach Dämmmaterial, für den Heizfall ≥19 Grad zwischen 12 und 16 cm bei Außenwänden und 16-20 cm beim Flachdach. Auf jeden Fall sollte die Bildung eines Wärmepolsters unter der Decke vermieden werden und unter Beachtung der Arbeitsschutzrichtlinien und des GEG eine möglichst geringe Temperatur angestrebt werden.
Bei der nachträglichen Dämmung der Wände ist aus bauphysikalischen Gründen eine Außendämmung vorzuziehen.
Es wurde nachgewiesen, dass es sich auch im Gewerbebau lohnt, besser als nach dem geforderten Standard zu dämmen. Die Kalkulation zeigt, dass mit einer besonders gut gedämmten Gebäudehülle (PU-Dämmstoffdicke 16 cm (U = 0,152 W/m²K) statt 6 cm (U = 0,369 W/m²K)) ca. 35 Prozent der Heizenergie eingespart werden können.
Um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern, sollte bei der Wahl der Dämmstoffe für die Außendämmung/Aufsparrendämmung bei Leichtkonstruktionen ein massereicher Dämmstoff mit hoher spezifischer Wärmekapazität eingesetzt werden. Durch die resultierende Phasenverschiebung zwischen Wärmeeinstrahlung und -wiederabgabe kann viel Energie für die Kühlung/Klimatisierung eingespart werden.
Eine andere Möglichkeit zur Minderung des Kühlbedarfs ist eine sehr gut hinterlüftete Vorhangfassade. Durch die Ausnutzung des Kamineffekts kann die Luft hinter der heißen Fassadenplatte/Dacheindeckung zirkulieren und die Wärme forttragen. Auch eine Photovoltaikanlage kann auf dem Süddach diesen Effekt erzielen, weil die Hinterlüftungsebene die in den Modulen entstandene Wärme abführt.
Die wichtigsten Energieeffizienzmaßnahmen:
Bei der nachträglichen Dämmung der Wände ist aus bauphysikalischen Gründen eine Außendämmung vorzuziehen.
Es wurde nachgewiesen, dass es sich auch im Gewerbebau lohnt, besser als nach dem geforderten Standard zu dämmen. Die Kalkulation zeigt, dass mit einer besonders gut gedämmten Gebäudehülle (PU-Dämmstoffdicke 16 cm (U = 0,152 W/m²K) statt 6 cm (U = 0,369 W/m²K)) ca. 35 Prozent der Heizenergie eingespart werden können.
Um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern, sollte bei der Wahl der Dämmstoffe für die Außendämmung/Aufsparrendämmung bei Leichtkonstruktionen ein massereicher Dämmstoff mit hoher spezifischer Wärmekapazität eingesetzt werden. Durch die resultierende Phasenverschiebung zwischen Wärmeeinstrahlung und -wiederabgabe kann viel Energie für die Kühlung/Klimatisierung eingespart werden.
Eine andere Möglichkeit zur Minderung des Kühlbedarfs ist eine sehr gut hinterlüftete Vorhangfassade. Durch die Ausnutzung des Kamineffekts kann die Luft hinter der heißen Fassadenplatte/Dacheindeckung zirkulieren und die Wärme forttragen. Auch eine Photovoltaikanlage kann auf dem Süddach diesen Effekt erzielen, weil die Hinterlüftungsebene die in den Modulen entstandene Wärme abführt.
Die wichtigsten Energieeffizienzmaßnahmen:
- Verbesserung des Wärmeschutzes (z. B. durch Dämmung insbesondere im Dach). Dabei nicht nur den Dämmwert - für den Winter - beachten, sondern auch die Wärmespeicherfähigkeit für den sommerlichen Wärmeschutz.
- Nutzung von hinterlüfteten Fassaden und Dächern.
- Lieber etwas besser dämmen als zu wenig.

|
| nachträglichen Dämmung |
| Copyright: HWK-Münster |
Modellbetriebe
Ein Modellbetrieb ist ein positives Beispiel, welches zeigen soll, dass es sich lohnt, die Aspekte der betrieblichen Energieeffizienz im Blick zu haben, um hier Kosten einzusparen. Die Modellbetriebe präsentieren sich in Form eines Steckbriefes, in dem umgesetzte oder noch geplante Maßnahmen des Betriebes vorgestellt werden:
Fech Fenstertechnik GmbH & Co. KG - 86695 Nordendorf
Fech Fenstertechnik GmbH & Co. KG - 86695 Nordendorf
Weiterführende Informationen / Infoblätter
Hier kommen Sie zu weitergehenden aktuellen Informationen zum Bauen und Sanieren:
Gebäudeforum klimaneutral
: zentrale Plattform der Deutschen Energie-Agentur (dena) für qualitätsgesicherte Informationen rund um klimaneutrales Bauen und SanierenBundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Nutzung von Fenstern mit guten thermischen Eigenschaften und geringen Wärmeverlusten.
Eine optimierte Nutzung von Tageslicht reduziert nicht nur den Anteil der benötigten künstlichen Beleuchtung und führt somit zu einem geringeren Stromverbrauch, sondern ist auch unabdingbar (und vorgeschrieben) für eine gute Arbeitsplatz-Atmosphäre. Um Wärmeverluste zu minimieren, sollten Fenster mit guten thermischen Eigenschaften (geringer U-Wert) verwendet werden. Der Einbau von Wärmeschutzverglasungen reduziert gegenüber einfach verglasten Fenstern und einschaligen Industrieverglasungen mit Uw-Werten von ca. 5,0 W/(m²K) den Transmissionswärmeverlust um bis zu 80% am Fensterbauteil.
Um eine Überhitzung der Innenräume zu vermeiden, ist der Einsatz eines außenliegenden Sonnenschutzes sinnvoll. Außenliegende Verschattungselemente können auch zur optimierten Lichtlenkung eingesetzt werden. Am besten - aber in der Regel nur beim Neubau zu realisieren - ist eine großflächige Verglasung mit einer steilstehenden Nordausrichtung (z.B. Sheddach).
Die wichtigsten Energieeffizienzmaßnahmen:
Um eine Überhitzung der Innenräume zu vermeiden, ist der Einsatz eines außenliegenden Sonnenschutzes sinnvoll. Außenliegende Verschattungselemente können auch zur optimierten Lichtlenkung eingesetzt werden. Am besten - aber in der Regel nur beim Neubau zu realisieren - ist eine großflächige Verglasung mit einer steilstehenden Nordausrichtung (z.B. Sheddach).
Die wichtigsten Energieeffizienzmaßnahmen:
- Nutzung von Fenstern mit guten thermischen Eigenschaften und geringen Wärmeverlusten.
- Einsatz eines effektiven außenliegenden Sonnenschutzes zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer (z. B. durch Lichtlenkung).
- Optimierung der Fensterflächenanteile entsprechend der Ausrichtung.
Hallentore / -türen
Betriebsbedingt ist es oft notwendig, die Hallentore häufig zu öffnen oder z.B. für das Beladen von Lkw über eine längere Zeitdauer geöffnet zu halten. So entstehen im Winter hohe Wärmeverluste, die noch verstärkt werden, wenn dazu noch ein gegenüber liegendes Tor geöffnet wird.
Wo sehr oft Tore geöffnet werden müssen, kommt es darauf an, die Öffnungszeiten möglichst kurz zu halten. Das ist z.B. mit der Hilfe von Schnelllauftoren möglich. Bei ihnen ist zwar konstruktionsbedingt die Dämmfunktion nicht so hoch, dafür aber ein schnelles und bequemes Schließen möglich. Für den Einbruchschutz müssen diese Tore in der Regel mit einem massiven Tor mit besseren Dämmeigenschaften kombiniert werden. Um nicht so viel Heizenergie zu verlieren, sollte die Luft im Raum eine möglichst niedrige Temperatur haben. Hier empfiehlt sich eine Strahlungsheizung, die weniger die Luft als vielmehr die Oberfläche von Massen erwärmt.
Grundsätzlich sollten die Betriebsabläufe so geplant werden, dass ein Passieren der Tore / Türen möglichst vermieden wird. Häufig kann das durch eine Umorganisation von Innen- und Außenlager erreicht werden.
Wo Tore weniger oft geöffnet werden, ist die gute thermische Eigenschaft und die Luftdichtheit der Toranlage besonders wichtig. Moderne Sektionaltore können diese Anforderungen erfüllen, aber auch bei ihnen kommt es darauf an, die Öffnungszeiten zu minimieren. Dazu ist es wichtig, dass die Mitarbeiter den Schließmechanismus leicht bedienen können. Wer auf dem Stapler sitzt, wird nicht zum Öffnen und Schließen immer wieder absteigen wollen und lässt öfter das Tor auf. Hat er eine Fernbedienung oder ist das Öffnen automatisiert, wird das die Öffnungszeit des Tores drastisch senken.
Toröffnung für Mitarbeiter beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes lässt sich durch Schlupf- oder Nebentüren vermeiden. Diese auch als Notausgangstüren nutzbare Türen reduzieren den Wärmeverlust drastisch. Dabei sind Nebentüren aus Gründen der mechanischen Stabilität zu bevorzugen. Häufig genutzte Außentüren zu gut beheizten Räumen sollten mit einem Windfang versehen sein.
Reduzieren lassen sich die Wärmeverluste auch durch den Einbau von Torluftschleieranlagen. Durch Düsen neben oder über dem Tor wird Luft so eingeblasen, dass sich eine „Luftwand“ bildet. Diese vermindert das Eindringen von Kaltluft und kann aber gleichzeitig problemlos von Menschen und Fahrzeugen durchschritten werden. Diese Technik ist besonders vorteilhaft bei ständig bzw. sehr lange geöffneten Toren oder Türen.
Zur Verringerung dieser Wärmeverluste können die folgenden Maßnahmen evtl. auch in Kombination beitragen:
Wo sehr oft Tore geöffnet werden müssen, kommt es darauf an, die Öffnungszeiten möglichst kurz zu halten. Das ist z.B. mit der Hilfe von Schnelllauftoren möglich. Bei ihnen ist zwar konstruktionsbedingt die Dämmfunktion nicht so hoch, dafür aber ein schnelles und bequemes Schließen möglich. Für den Einbruchschutz müssen diese Tore in der Regel mit einem massiven Tor mit besseren Dämmeigenschaften kombiniert werden. Um nicht so viel Heizenergie zu verlieren, sollte die Luft im Raum eine möglichst niedrige Temperatur haben. Hier empfiehlt sich eine Strahlungsheizung, die weniger die Luft als vielmehr die Oberfläche von Massen erwärmt.
Grundsätzlich sollten die Betriebsabläufe so geplant werden, dass ein Passieren der Tore / Türen möglichst vermieden wird. Häufig kann das durch eine Umorganisation von Innen- und Außenlager erreicht werden.
Wo Tore weniger oft geöffnet werden, ist die gute thermische Eigenschaft und die Luftdichtheit der Toranlage besonders wichtig. Moderne Sektionaltore können diese Anforderungen erfüllen, aber auch bei ihnen kommt es darauf an, die Öffnungszeiten zu minimieren. Dazu ist es wichtig, dass die Mitarbeiter den Schließmechanismus leicht bedienen können. Wer auf dem Stapler sitzt, wird nicht zum Öffnen und Schließen immer wieder absteigen wollen und lässt öfter das Tor auf. Hat er eine Fernbedienung oder ist das Öffnen automatisiert, wird das die Öffnungszeit des Tores drastisch senken.
Toröffnung für Mitarbeiter beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes lässt sich durch Schlupf- oder Nebentüren vermeiden. Diese auch als Notausgangstüren nutzbare Türen reduzieren den Wärmeverlust drastisch. Dabei sind Nebentüren aus Gründen der mechanischen Stabilität zu bevorzugen. Häufig genutzte Außentüren zu gut beheizten Räumen sollten mit einem Windfang versehen sein.
Reduzieren lassen sich die Wärmeverluste auch durch den Einbau von Torluftschleieranlagen. Durch Düsen neben oder über dem Tor wird Luft so eingeblasen, dass sich eine „Luftwand“ bildet. Diese vermindert das Eindringen von Kaltluft und kann aber gleichzeitig problemlos von Menschen und Fahrzeugen durchschritten werden. Diese Technik ist besonders vorteilhaft bei ständig bzw. sehr lange geöffneten Toren oder Türen.
Zur Verringerung dieser Wärmeverluste können die folgenden Maßnahmen evtl. auch in Kombination beitragen:
- Einbau von Schnelllauftoren dann, wenn häufiges Toröffnen verlangt ist.
- Je weniger die Tore geöffnet sind, umso mehr sollte auf die Wärmedämmeigenschaft und die Luftdichtheit der Tore geachtet werden.
- Betriebsabläufe so planen, dass möglichst wenig Torpassagen nötig sind.
- Öffnen und Schließen der Tore / Türen möglichst einfach machen oder automatisieren.
- Dichtungen verschleißen schnell ⇒ regelmäßige Inspektionen durchführen lassen.

|
| IR-Bild Sektionaltor |
| Copyright: HWK-Münster |
Energieeffizienz der Gebäudehülle
Aufgabe einer Gebäudehülle ist es, im Inneren eine von den klimatischen Einflüssen unabhängige und für den Mitarbeiter akzeptable Umgebung zu schaffen. Gleichzeitig soll sie z.B. für die Nachbarschaft störende Schallemissionen dämpfen, die Einrichtung sichern…., zusammengefasst: die Emissionen und Immissionen zu mindern.
Nicht alle Bereiche in einem Betriebsgebäude müssen die gleiche Temperatur haben. Während sich z.B. Mitarbeiter mit überwiegend sitzender Tätigkeit in der Regel bei Temperaturen von ca. 21°C wohlfühlen, finden Mitarbeiter bei körperlich anstrengende Arbeiten - wohlmöglich in der Nähe von Schmelzöfen o.Ä. - eine Lufttemperatur von 12-19°C angenehm. Ein Lager muss nicht unbedingt geheizt sein, wenn die Waren darin frost- oder hitzefest sind. Daher bestimmt die Art der Nutzung die Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen im Gebäude.
Nicht alle Bereiche in einem Betriebsgebäude müssen die gleiche Temperatur haben. Während sich z.B. Mitarbeiter mit überwiegend sitzender Tätigkeit in der Regel bei Temperaturen von ca. 21°C wohlfühlen, finden Mitarbeiter bei körperlich anstrengende Arbeiten - wohlmöglich in der Nähe von Schmelzöfen o.Ä. - eine Lufttemperatur von 12-19°C angenehm. Ein Lager muss nicht unbedingt geheizt sein, wenn die Waren darin frost- oder hitzefest sind. Daher bestimmt die Art der Nutzung die Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen im Gebäude.

|
| Energiebilanz Gebäude |
| Copyright: HWK-Münster |
Betrieb baulich so unterteilen, dass eine thermische Zonierung möglich ist.
In der Regel müssen nicht alle Bereiche im Unternehmen gleich temperiert sein. Während in Büros, Aufenthaltsräumen oder Arbeitsbereichen mit überwiegend sitzender Tätigkeit im Heizfall eine Temperatur von ca. 21°C herrschen sollte, werden bei körperlich schweren Arbeiten Temperaturen im Heizfall von 12 bis < 19 °C als angenehm empfunden. Aus technischen Erfordernissen, wie z.B. in der Feinmechanik, sind (konstante) Temperaturen um 20°C gefordert. Andere Bereiche wie z.B. reine Lager benötigen – mit Ausnahme kälte- oder frostempfindlicher Materialien – gar keine Heizung. Daher ist es wichtig, den Wärmebedarf der einzelnen Bereiche im Betrieb zu ermitteln und regelmäßig zu hinterfragen.
Eine angepasste Temperatur lässt sich aber nur dann einstellen, wenn die Bereiche voneinander thermisch trennbar sind. Das kann baulich durch Wände und durch Türen oder (Schnelllauf-)Tore erreicht werden. Aber auch der Dämmstandard der Wände sollte dem Temperaturgefälle Rechnung tragen. So ist z.B. die Wand zwischen einem Büro und einem ungeheizten Lager so zu dämmen wie ansonsten die thermische Außenhülle.
Bei einigen Betrieben werden innerhalb einer Halle verschiedene Temperaturen benötigt. Dies kann z.B. bei der punktuellen Beheizung einzelner Arbeitsplätze oder -bereiche aber auch bei Abschnitten mit verschiedenen Arbeitsanforderungen der Fall sein. Hier bietet sich die Installation einer Strahlungsheizung an, die direkt die entsprechenden Bereiche erwärmt, wobei die übrigen Bereiche kühler bleiben und keine Zugerscheinungen auftreten.
Eine angepasste Temperatur lässt sich aber nur dann einstellen, wenn die Bereiche voneinander thermisch trennbar sind. Das kann baulich durch Wände und durch Türen oder (Schnelllauf-)Tore erreicht werden. Aber auch der Dämmstandard der Wände sollte dem Temperaturgefälle Rechnung tragen. So ist z.B. die Wand zwischen einem Büro und einem ungeheizten Lager so zu dämmen wie ansonsten die thermische Außenhülle.
Bei einigen Betrieben werden innerhalb einer Halle verschiedene Temperaturen benötigt. Dies kann z.B. bei der punktuellen Beheizung einzelner Arbeitsplätze oder -bereiche aber auch bei Abschnitten mit verschiedenen Arbeitsanforderungen der Fall sein. Hier bietet sich die Installation einer Strahlungsheizung an, die direkt die entsprechenden Bereiche erwärmt, wobei die übrigen Bereiche kühler bleiben und keine Zugerscheinungen auftreten.
- Betrieb baulich so unterteilen, dass eine thermische Zonierung möglich ist.
- In den Zonen Temperatur anpassen.
- Übergang von einer Temperaturzone in die andere möglichst einfach machen, insbesondere dann, wenn das Temperaturgefälle groß ist (Automatiktüren, Schnelllauftore …).
- Wärmebedürfnis mit den Mitarbeitern absprechen.
Um eine wärmedämmende Gebäudehülle zu erstellen, müssen die zwei Hauptarten der Wärmeverlustmöglichkeiten berücksichtigt werden, nämlich die Transmissions- und Lüftungswärmeverluste. Die Transmissionswärmeverluste beruhen darauf, dass alle Konstruktions- aber auch die Dämmmaterialien (mit Ausnahme des Vakuums) bei unterschiedlicher Innen- und Außentemperatur den ausgleichenden Wärmestrom zwar dämpfen (⇒Dämmung), nicht aber unterbinden (⇒Isolierung). Maß für den Transmissionswärmeverlust ist der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert mit der Maßeinheit Watt pro Quadratmeter und Kelvin [W/(m²·K)].
Die Außenwände stellen in der Regel die größte Fläche der Gebäudehülle mit entsprechend hohem Anteil an Wärmeverlusten durch Transmission dar. Die Dämmung der Außenwände bietet daher ein großes Potenzial in Bezug auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes.
Sowohl bei einer Sanierung als auch beim energieeffizienten Neubau ist es wichtig, die thermische Hülle zu definieren. Die dämmende Hülle muss möglichst lückenlos das beheizte Volumen umschließen. Die über die wärmeübertragende Umfassungsfläche gemittelten U-Werte bilden den spezifischen Transmissionsverlust HT´.
Die Außenwände stellen in der Regel die größte Fläche der Gebäudehülle mit entsprechend hohem Anteil an Wärmeverlusten durch Transmission dar. Die Dämmung der Außenwände bietet daher ein großes Potenzial in Bezug auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes.
Sowohl bei einer Sanierung als auch beim energieeffizienten Neubau ist es wichtig, die thermische Hülle zu definieren. Die dämmende Hülle muss möglichst lückenlos das beheizte Volumen umschließen. Die über die wärmeübertragende Umfassungsfläche gemittelten U-Werte bilden den spezifischen Transmissionsverlust HT´.

|
| Wärmeleitfähigkeit |
| Copyright: Handwerkskammer Münster |
Außenwand
Der mittlere U-Wert der Wandelemente beträgt bei einem Neubau eines Nichtwohngebäudes maximal 0,28 W/(m²K). Das entspricht grob einem Mauerwerk mit einer ca. 14 cm dicken Dämmebene. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Fassadendämmung. Welche davon genutzt wird, richtet sich in erster Linie nach dem Wandaufbau des Gebäudes:
- Monolithisches Mauerwerk – hier hat das Mauerwerk sowohl tragende als auch dämmende Funktion. Die Steine bestehen entweder aus hochporösem Porenbeton oder Ziegel mit hohem Porenanteil und/oder mit Dämmmaterial gefüllten Gitterstrukturen. Problematisch können Details wie z.B. einbindende/aufliegende Betonteile sein, die den Wandaufbau konstruktionsbedingt verschlanken.
- Wärmedämm-Verbundsystem – das Dämmmaterial wird direkt von außen auf die Wand aufgebracht und anschließend verputzt. Diese Art der Dämmung (zumeist mit Polystyrol- oder Mineralwolleplatten) ist geeignet, um Wärmebrücken durch Material-Inhomogenitäten zu überdämmen.
- Kerndämmung – der Hohlraum einer 2-schaligen Wand wird mit Dämmstoff gefüllt. Nachträglich lässt sich der Luftspalt mit Dämmstoff im Einblasverfahren ausfüllen.
- Innendämmung – die Dämmung wird auf der Innenseite der Fassade angebracht. Diese Art der zumeist nachträglichen Dämmung ist aus bauphysikalischen Gründen mit Vorsicht zu genießen, da auf der Innenseite einbindende Bauteile (Wände, Decken..) Wärmebrücken darstellen. Außerdem kann die Verlagerung des Taupunktes durch die Dämmung auf die Innenseite des Mauerwerks zu Problemen führen. Die Innendämmung sollte nur dann angewendet werden, wenn eine Außendämmung, z.B. durch Denkmalschutzauflagen, nicht möglich ist oder nur einzelne Räume gedämmt werden sollen.
- Vorhangfassade – gerade im Gewerbebau wird – auch zur konstruktiven Flexibilität – die tragende und dämmende Ebene der Wand getrennt. Der tragende Teil kann aus einem Stahl-, Beton- oder Holz-Rahmensystem oder einer Mauerwerkswand bestehen. Unabhängig davon wird eine Dämmebene aus Stahlblech-PU-Sandwichelementen oder Dämmstoff-gefüllten Holztafelelementen vorgehängt.

|
| Wandtypen |
| Copyright: HWK-Münster |
Die Anforderungen an die Außenwand umfasst nicht nur die Optimierung der Dämmwirkung der Wand, sondern auch die Reduzierung der Verluste über Wärmebrücken. Als Wärmebrücken werden örtlich begrenzte Bereiche in der wärmeübertragenden Hülle eines Bauwerks bezeichnet, die eine höhere Wärmestromdichte als die benachbarten ungestörten Bauteile aufweisen. Diese Bereiche sind hinsichtlich der Wärmedämmung eine Schwachstelle in der Konstruktion, da es hier zu erhöhten Wärmeverlusten aus Transmission kommt. Mit zunehmendem Dämmstandard bekommen die Wärmebrücken als wärmetechnische Schwachstelle immer mehr Bedeutung und das nicht nur unter energetischen Aspekten, sondern auch wegen dem unmittelbaren Einfluss auf die hygienischen Bedingungen im Innenraum.
Aufgrund der höheren Wärmestromdichte im Bereich von Wärmebrücken verringern sich die Oberflächentemperaturen des Bauteils auf der Rauminnenseite. Dies hat unterschiedliche Folgen:
Aufgrund der höheren Wärmestromdichte im Bereich von Wärmebrücken verringern sich die Oberflächentemperaturen des Bauteils auf der Rauminnenseite. Dies hat unterschiedliche Folgen:
- Die stärkere Abkühlung auf der Raumseite der Konstruktion; dadurch kann es zu Einschränkungen bei der Behaglichkeit kommen, da das Bauteil als kalt empfunden wird. Zusätzlich kann es zu Strahlungsasymmetrien zwischen anderen angrenzenden Bauteilen kommen, die als unbehaglich empfunden werden.
- Die höhere Wärmestromdichte der Wärmebrücke bedeutet auch höhere energetische Verluste in diesem Bereich.
- Durch das geringere Temperaturniveau des kalten Bauteils kommt es in der Grenzschicht der Luft zu einer Erhöhung der relativen Luftfeuchte bis hin zum Ausfall von Tauwasser auf dem Bauteil. Ab einer relativen Luftfeuchte von 80% besteht die Gefahr eines Schimmelpilzbefalls. Wärmebrücken führen häufig zu einem hygienischen und ggf. gesundheitlichen Problem.

|
| ungedämmte Fensterbrüstung |
| Copyright: HWK-Münster |
Dach
Das Dach ist den Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen am stärksten ausgesetzt. Da die Raumluft in der Regel unter der Decke am wärmsten ist, ist das Temperaturgefälle im Dach besonders hoch. Dadurch wird hier eine besonders gute Wärmedämmung benötigt. Dächer von Gewerbehallen sind meistens Leichtbaukonstruktionen, wie z.B. Trapezblech mit Dämmschicht und Eindichtung oder Sparrendächer mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung. Wegen des hohen Temperaturgefälles und der Art der Konstruktion ist die Luftdichtung auf der Dach-Decken-Innenseite besonders wichtig: Gelangt die feuchte und warme Luft in die Dämmebene und kühlt sich dort ab, fällt bei Erreichen des Taupunktes Wasser aus und durchfeuchtet die Dämmung. Diese verliert dadurch einen großen Teil der Dämmwirkung. Insbesondere bei Holz kommt es schnell zu Schäden an der Tragkonstruktion.
Da die wasserführende, obere Schicht des Daches (Folie, Bitumenbahn, Blech oder Dachpfannen) in der Regel hinterlüftet ist, kann bei Undichtigkeiten der inneren Ebene zudem viel Wärme durch Diffusion entweichen.
Im Sommer ist das Dach der Sonnenstrahlung am intensivsten ausgesetzt und heizt sich am stärksten auf. Um zu vermeiden, dass sich die darunter befindlichen Räume überhitzen und die Wärme energieintensiv weggekühlt werden muß, gibt es verschiedene Strategien:
Da die wasserführende, obere Schicht des Daches (Folie, Bitumenbahn, Blech oder Dachpfannen) in der Regel hinterlüftet ist, kann bei Undichtigkeiten der inneren Ebene zudem viel Wärme durch Diffusion entweichen.
Im Sommer ist das Dach der Sonnenstrahlung am intensivsten ausgesetzt und heizt sich am stärksten auf. Um zu vermeiden, dass sich die darunter befindlichen Räume überhitzen und die Wärme energieintensiv weggekühlt werden muß, gibt es verschiedene Strategien:
- Das Dach wird mit Materialien gedämmt, die die eingestrahlte Wärme mittelfristig speichern können. Hierfür geeignet sind z.B. Holzfaser-Dämmplatten, die bei einer hohen Rohdichte und spezifischen Wärmekapazität die eingestrahlte Wärme bis zu 12 Std. speichern und erst verzögert wieder abgeben (Phasenverschiebung).
- Die oberste Schicht des Daches oder auch der Wand wird sehr gut hinterlüftet: Sobald die Luft zwischen Deckschicht und Dämmung warm genug ist, steigt sie auf und verlässt die Konstruktion durch dafür vorgesehene Öffnungen (Hutzen oder Lüfterpfannen). Durch den Auftrieb entsteht im Dach ein Unterdruck und kühlere Außenluft kann nachströmen. Nicht so gut geeignet ist diese Strategie bei Flachdächern, da sich in diesen ein Kamineffekt nur schlecht entwickelt.
Lichtdurchlässige Bauteile
Fenster und Fenstersysteme sind auch im Gewerbebau Gebäudekomponenten mit vielfältigen Anforderungen an Funktion und Gestaltung: Im Winter wenig Raumwärme hinaus-, aber viel Solarwärme hereinlassen, im Sommer den solaren Wärmeeintrag begrenzen und immer möglichst viel Tageslicht ins Innere leiten.
Bei der Technologie der Verglasung haben sich in den letzten Jahren die größten Veränderungen ergeben. Durch die Entwicklung der Mehrfachverglasungen, der Beschichtung der Gläser mit Metallfolien/-bedampfungen und der Füllung der Zwischenräume mit Edelgasen hat sich die Wärmedurchlässigkeit der Verglasung um einen Faktor 10 verbessert. Das ist nicht nur für den Heizwärmebedarf wichtig, sondern auch für den Raumkomfort.
Neben dem winterlichen Wärmeschutz, der die Kosten für die Beheizung bestimmt, kann auch der sommerliche Wärmeschutz zur Vermeidung von Kosten für die Kühlung / Klimatisierung wichtig sein. Hierbei haben die lichtdurchlässigen Bauteile die größte Relevanz.
Bei der Technologie der Verglasung haben sich in den letzten Jahren die größten Veränderungen ergeben. Durch die Entwicklung der Mehrfachverglasungen, der Beschichtung der Gläser mit Metallfolien/-bedampfungen und der Füllung der Zwischenräume mit Edelgasen hat sich die Wärmedurchlässigkeit der Verglasung um einen Faktor 10 verbessert. Das ist nicht nur für den Heizwärmebedarf wichtig, sondern auch für den Raumkomfort.
Neben dem winterlichen Wärmeschutz, der die Kosten für die Beheizung bestimmt, kann auch der sommerliche Wärmeschutz zur Vermeidung von Kosten für die Kühlung / Klimatisierung wichtig sein. Hierbei haben die lichtdurchlässigen Bauteile die größte Relevanz.

|
| Arten der Verglasung |
| Copyright: HWK-Münster |
Grundsätzich gibt es bei der Verglasung von Räumen den Zielkonflikt, dass zwar möglichst viel Tageslicht gewünscht oder gefordert ist (min. 20%), Fenster und Lichtbänder aber in Punkto Wärmedämmeigenschaften (bis auf die Dreifachverglasung) immer schlechter sind als opake Wände. Aus Sicht des Heizenergiebedarfs sollten im Winter die Fenster also möglichst klein und aus Sicht des Stromverbrauchs für Beleuchtung möglichst groß sein. Im Sommer sind die transluzenten Bauteile problematisch, da bei fehlendem oder falschem Sonnenschutz eine Überhitzung der Räume droht, die nur durch zusätzliche Lüftung oder Klimatisierung reduziert werden kann. Ist die kurzwellige Sonnenstrahlung erst einmal durch die Verglasung in den Raum gelangt und trifft auf Masse (z.B. den Fußboden), wird ein Teil der Strahlung reflektiert, der andere absorbiert. Letzterer Anteil erzeugt (langwellige) Wärme, die in den Raum abstrahlt und zur Aufheizung führt.
Eine Strategie zur Vermeidung einer Überhitzung durch die warme Außenluft kann z.B. sein, nachts die kühle Luft zum Herunterkühlen zu nutzen und die (Fenster-)Lüftung über Tag zu minimieren. Grenzen sind durch die – allerdings seltenen - tropischen Nächte gesetzt.
Ein Überhitzen über die transluzenten Bauteile wie Fenster, Lichtbänder … kann nur durch einen effektiven Sonnenschutz erfolgen. Dieser muss außerhalb der Fenster angebracht sein, denn ist die kurzwellige Sonnenstrahlung erst einmal im Gebäudeinneren, wandelt sie sich in langwellige Wärmestrahlung. Eine totale Verdunkelung ist zumeist nicht sinnvoll, da ansonsten Strom für die Beleuchtung eingesetzt werden müsste. Ein guter Kompromiss sind bei vertikalen Fensterflächen außen liegende Lamellenstores, die in ihrem oberen Teil Lichtlenk-Lamellen haben und einen Teil der Strahlung an die Decke reflektieren.
Eine Strategie zur Vermeidung einer Überhitzung durch die warme Außenluft kann z.B. sein, nachts die kühle Luft zum Herunterkühlen zu nutzen und die (Fenster-)Lüftung über Tag zu minimieren. Grenzen sind durch die – allerdings seltenen - tropischen Nächte gesetzt.
Ein Überhitzen über die transluzenten Bauteile wie Fenster, Lichtbänder … kann nur durch einen effektiven Sonnenschutz erfolgen. Dieser muss außerhalb der Fenster angebracht sein, denn ist die kurzwellige Sonnenstrahlung erst einmal im Gebäudeinneren, wandelt sie sich in langwellige Wärmestrahlung. Eine totale Verdunkelung ist zumeist nicht sinnvoll, da ansonsten Strom für die Beleuchtung eingesetzt werden müsste. Ein guter Kompromiss sind bei vertikalen Fensterflächen außen liegende Lamellenstores, die in ihrem oberen Teil Lichtlenk-Lamellen haben und einen Teil der Strahlung an die Decke reflektieren.

|
| solare Wärmeentwicklung |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| Schaufenster im Winter |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| Schaufenster im Sommer |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| innenliegender Sonnenschutz |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| Schaufenster mit Vordach |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| aussenliegendem Sonnenschutz |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| Lichtlenk-Lamellen |
| Copyright: HWK-Münster |
Bei Oberlichtern oder Lichtkuppeln im Dach besteht das Problem, dass eine wetterfeste Verschattung auf der Außenseite selten möglich ist. Hier ist oft nur ein Blendschutz auf der Innenseite möglich.
Bei einem sägezahnförmigen Sheddach ist zumeist die lichtundurchlässige Seite nach Süden gewandt und die transluzente Fläche nach Norden. So wird erreicht, dass - wie beim Atelierfenster - das ganze Jahr über das blendfreie, diffuse Nordlicht einfällt. Mit der Konstruktion wird im Sommer auch ein angenehmes Raumklima ohne Überhitzungen gewährleistet.
Bei einem sägezahnförmigen Sheddach ist zumeist die lichtundurchlässige Seite nach Süden gewandt und die transluzente Fläche nach Norden. So wird erreicht, dass - wie beim Atelierfenster - das ganze Jahr über das blendfreie, diffuse Nordlicht einfällt. Mit der Konstruktion wird im Sommer auch ein angenehmes Raumklima ohne Überhitzungen gewährleistet.

|
| Halle mit Lichtbändern |
| Copyright: HWK-Münster |

|
| Halle mit Sheddach |
| Copyright: HWK-Münster |
Tore
In fast allen Gewerbebauten sind z.T. sehr großflächige Tore zu finden. Diese sind für die Zulieferung und den Abtransport von Gütern erforderlich. Während im Sommer über die offenen Tore Frischluft in die Halle kommen kann, sollten die Tore natürlich im Winter möglichst immer geschlossen sein. Ansonsten ist dem Wärmeverlust "Tür und Tor" geöffnet.
Betrachtet man die auf dem Markt gängigen Torsysteme (Sektionaltor, Folien-Rolltor, Lamellen-Rolltor, Schnelllaufspiraltor), gibt es hier große Unterschiede hinsichtlich Aufbau, Materialien und Dämmung, Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und Steuerungstechniken. Für eine Bewertung der Tore sind neben dem U-Wert der Tore, die Luftdichtigkeit, die Torfläche, die Öffnungszeit und -geschwindigkeit und – nicht zu vergessen – die Temperatur in der Halle wichtig.
Es hat sich
Grundsätzlich sollte bei geringen Öffnungszyklen aus energetischer Sicht auf eine hohe Dämmung und Dichtheit des geschlossenen Tores geachtet werden. Bei häufigen Öffnungszyklen ist vorrangig die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Tores relevant. Dämmung und Dichtheit des Tores haben einen untergeordneten Einfluss. In diesem Fall sollte darauf geachtet werden, dass die Raumluft-Temperatur in der Nähe der Tore möglichst gering ist. Das kann z.B. dadurch erreicht werden, dass für die Beheizung überwiegend Strahlungsheizung (Hell-, Dunkelstrahler oder Deckenstrahlplatten) eingesetzt wird.
Die Zahl der Toröffnungen lässt sich in der Regel auch senken, wenn Innen- und Außenlager so organisiert sind, dass alle häufig benötigten Teile und die Halbfertigprodukte in der Halle gelagert werden.
Zur Steigerung der thermischen Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft und zur Minimierung des Luftwechsels zwischen Innen und Außen können Luftschleier- oder Luftwandanlagen eingesetzt werden.
Besonders wichtig ist es aber, dass man es den Mitarbeitern leicht macht, die Tore zu schließen, oder automatisiert mittels moderner sensorischer Systeme den Aufwand vermindert.
Um die Zahl der Toröffungen zu begrenzen, ist es in der Regel sinnvoll, Schlupf- oder Nebentüren für die Personen einzubauen, die - ohne Fahrzeug - das Gebäude verlassen oder betreten. Mechanisch stabiler und besser zu dämmen sind dabei die Nebentüren.
Betrachtet man die auf dem Markt gängigen Torsysteme (Sektionaltor, Folien-Rolltor, Lamellen-Rolltor, Schnelllaufspiraltor), gibt es hier große Unterschiede hinsichtlich Aufbau, Materialien und Dämmung, Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und Steuerungstechniken. Für eine Bewertung der Tore sind neben dem U-Wert der Tore, die Luftdichtigkeit, die Torfläche, die Öffnungszeit und -geschwindigkeit und – nicht zu vergessen – die Temperatur in der Halle wichtig.
Es hat sich
gezeigt
, dass öffnungsbedingter Lüftungswärmeverlust bereits bei einer 3-minütigen Öffnungsdauer pro Stunde während der Nutzungszeit den Wärmeverlust durch Transmission und Leckagen des Tores übersteigt. Bei gleichzeitigem Öffnen von gegenüberliegenden Toren kann sich der torbedingte Mehrbedarf an Wärme nochmals um mehr als 10 % im Vergleich zu einem hintereinander erfolgten Öffnen zweier Tore erhöhen.Grundsätzlich sollte bei geringen Öffnungszyklen aus energetischer Sicht auf eine hohe Dämmung und Dichtheit des geschlossenen Tores geachtet werden. Bei häufigen Öffnungszyklen ist vorrangig die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Tores relevant. Dämmung und Dichtheit des Tores haben einen untergeordneten Einfluss. In diesem Fall sollte darauf geachtet werden, dass die Raumluft-Temperatur in der Nähe der Tore möglichst gering ist. Das kann z.B. dadurch erreicht werden, dass für die Beheizung überwiegend Strahlungsheizung (Hell-, Dunkelstrahler oder Deckenstrahlplatten) eingesetzt wird.
Die Zahl der Toröffnungen lässt sich in der Regel auch senken, wenn Innen- und Außenlager so organisiert sind, dass alle häufig benötigten Teile und die Halbfertigprodukte in der Halle gelagert werden.
Zur Steigerung der thermischen Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft und zur Minimierung des Luftwechsels zwischen Innen und Außen können Luftschleier- oder Luftwandanlagen eingesetzt werden.
Besonders wichtig ist es aber, dass man es den Mitarbeitern leicht macht, die Tore zu schließen, oder automatisiert mittels moderner sensorischer Systeme den Aufwand vermindert.
Um die Zahl der Toröffungen zu begrenzen, ist es in der Regel sinnvoll, Schlupf- oder Nebentüren für die Personen einzubauen, die - ohne Fahrzeug - das Gebäude verlassen oder betreten. Mechanisch stabiler und besser zu dämmen sind dabei die Nebentüren.

|
| IR-Bild Sektionaltor |
| Copyright: HWK-Münster |