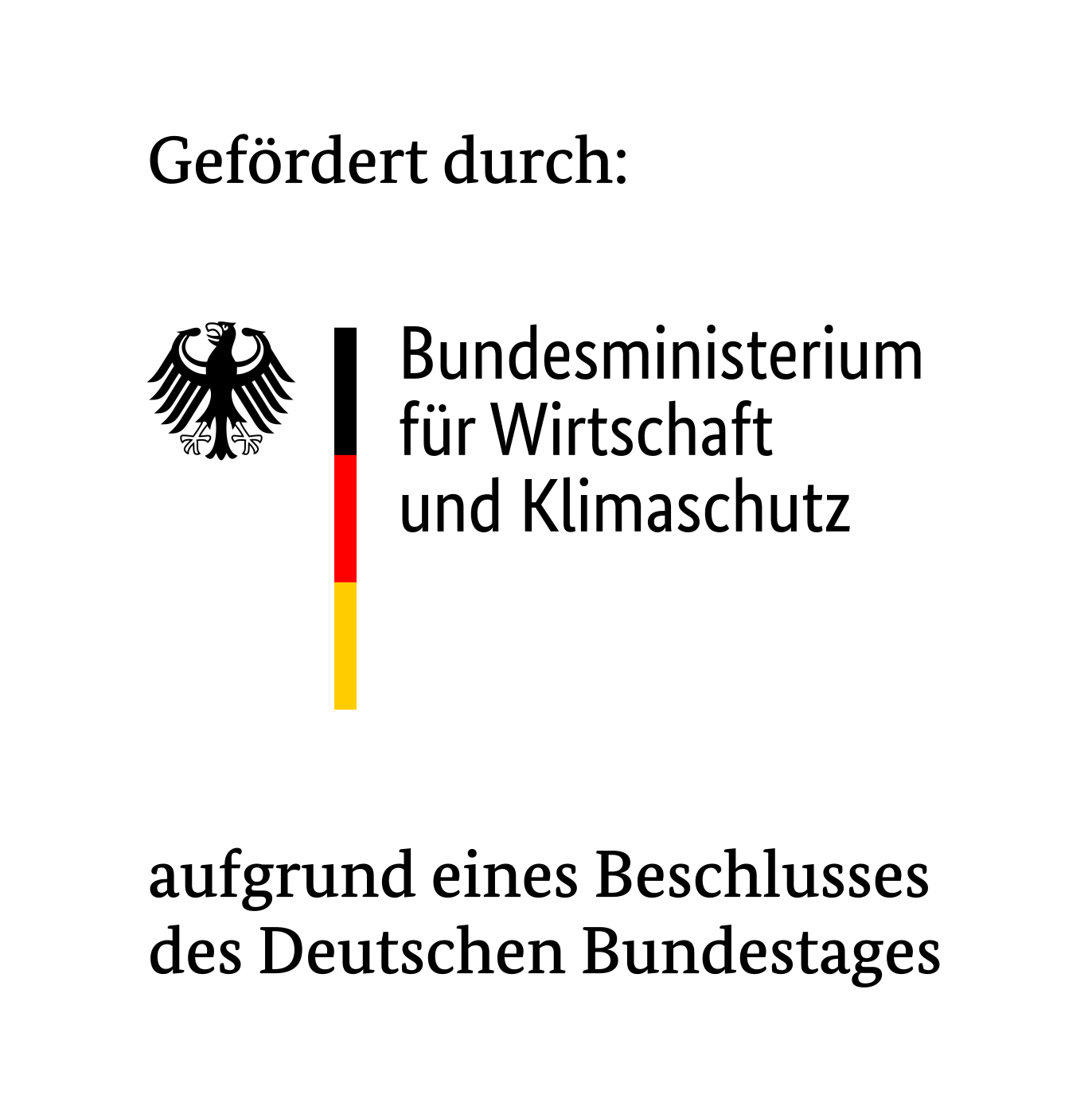Organisation & Controlling
Grundlegendes
Wegen der großen Bedeutung der Energiekosten ist es für Betriebe äußerst sinnvoll über eine monatliche Erfassung von Verbräuchen den Einstieg in ein Energiecontrolling vorzubereiten. Dies hilft hohe jährliche Energiekostennachzahlungen zu vermeiden und ermöglicht es ggf. System-Störungen frühzeitig zu erkennen.
Energiecontrolling beginnt in seiner einfachsten Form bei der Archivierung von Energieverbrauchsdaten in Form von Rechnungen an einem zentralen Ort. Die Erfahrung zeigt, dass gerade dies aber bei einer großen Anzahl von Betrieben nicht gegeben ist.
Zielführendes Energiecontrolling beruht auf der Nutzung von Energieeffizienzkennzahlen. Diese werden herangezogen, um die energetische Qualität von Produkten, Bauwerken, Prozessen, Produktionsstätten und Unternehmen zu beschreiben und diese vergleichen zu können. Üblicherweise werden sie errechnet, indem man den Energieverbrauch in einer bestimmten Zeitspanne – üblicherweise den Energieverbrauch eines Jahres – in Bezug zu einer Vergleichsgröße setzt. Für Betriebe sind sowohl technische Indikatoren – wie z.B. der Energieverbrauch pro produzierter Einheit in einer bestimmten Fertigungsstufe oder über den gesamten Produktionsprozess hinweg – relevant, als auch wirtschaftliche Indikatoren, bei denen monetäre Größen in die Berechnung mit einfließen. Zu letzterer Gruppe zählen beispielsweise Kennzahlen, wie die Energiekosten als Anteil der Gesamtkosten oder die kWh Energieeinsatz pro Euro Umsatz. Aber auch andere Kenngrößen, wie der spezifische Energieverbrauch pro Mitarbeiter/In, kommen in Frage (
Solche branchentypische Energieeffizienzkennzahlen dienen den Betrieben zur kontinuierlichen Beobachtung und Kontrolle ihres Energieeinsatzes im Zeitverlauf. Ein Vergleich der Kennzahlen mit dem Branchendurchschnitt erlaubt eine erste Einschätzung der Positionierung des eigenen Betriebes innerhalb der Branche und bietet einen wertvollen Ansatzpunkt, um Gründe für Abweichungen zu analysieren und mögliche Verbesserungsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen. Grundlage hierfür ist allerdings ein entsprechendes Monitoring, d.h., eine fortdauernde, systematische Erfassung (Protokollierung) bzw. Überwachung der jeweiligen Kennzahlen und deren Bewertung auf der Basis der eigenen Betriebsziele.
Als Einstieg in ein grundlegendes Energiecontrolling empfehlen wir das für kleine und kleinste Betriebe optimierte
Um Energieeffizienzmaßnahmen in einem Unternehmen noch wirkungsvoller umsetzen zu können, ist die Einführung eines etablierten Energiemanagementsystems (z.B.
Energiecontrolling beginnt in seiner einfachsten Form bei der Archivierung von Energieverbrauchsdaten in Form von Rechnungen an einem zentralen Ort. Die Erfahrung zeigt, dass gerade dies aber bei einer großen Anzahl von Betrieben nicht gegeben ist.
Zielführendes Energiecontrolling beruht auf der Nutzung von Energieeffizienzkennzahlen. Diese werden herangezogen, um die energetische Qualität von Produkten, Bauwerken, Prozessen, Produktionsstätten und Unternehmen zu beschreiben und diese vergleichen zu können. Üblicherweise werden sie errechnet, indem man den Energieverbrauch in einer bestimmten Zeitspanne – üblicherweise den Energieverbrauch eines Jahres – in Bezug zu einer Vergleichsgröße setzt. Für Betriebe sind sowohl technische Indikatoren – wie z.B. der Energieverbrauch pro produzierter Einheit in einer bestimmten Fertigungsstufe oder über den gesamten Produktionsprozess hinweg – relevant, als auch wirtschaftliche Indikatoren, bei denen monetäre Größen in die Berechnung mit einfließen. Zu letzterer Gruppe zählen beispielsweise Kennzahlen, wie die Energiekosten als Anteil der Gesamtkosten oder die kWh Energieeinsatz pro Euro Umsatz. Aber auch andere Kenngrößen, wie der spezifische Energieverbrauch pro Mitarbeiter/In, kommen in Frage (
weitere Beispiele
).
Solche branchentypische Energieeffizienzkennzahlen dienen den Betrieben zur kontinuierlichen Beobachtung und Kontrolle ihres Energieeinsatzes im Zeitverlauf. Ein Vergleich der Kennzahlen mit dem Branchendurchschnitt erlaubt eine erste Einschätzung der Positionierung des eigenen Betriebes innerhalb der Branche und bietet einen wertvollen Ansatzpunkt, um Gründe für Abweichungen zu analysieren und mögliche Verbesserungsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen. Grundlage hierfür ist allerdings ein entsprechendes Monitoring, d.h., eine fortdauernde, systematische Erfassung (Protokollierung) bzw. Überwachung der jeweiligen Kennzahlen und deren Bewertung auf der Basis der eigenen Betriebsziele.
Als Einstieg in ein grundlegendes Energiecontrolling empfehlen wir das für kleine und kleinste Betriebe optimierte
E-Tool
Webportal, welches die Erfassung der grundlegenden Energiedaten unterstützt (z.B. Stromrechnungen, Gas- und Heizölrechnungen, Tankrechnungen, Lieferverträge, Fahrzeuge, Maschinendaten etc.), umfangreiche Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten bietet und zudem hilfreiche Zusatzwerkzeuge zur Verfügung stellt (Strom- und Energiesteuerrechner, PV-Berechnungs-Tool, Darstellung von Lastgangprofilen etc.). Sofern darüber hinaus weitergehende Schritte angedacht sind, sollte ggf. über das Hinzuziehen eines professionellen Energieberaters nachgedacht werden (Förderung ist möglich).Um Energieeffizienzmaßnahmen in einem Unternehmen noch wirkungsvoller umsetzen zu können, ist die Einführung eines etablierten Energiemanagementsystems (z.B.
ISO 50001
) oder Umweltmanagementsystems (z.B. EMAS
– beinhaltet auch eine Energiekomponente) sinnvoll. Dieses kann je nach Betriebsgröße aus recht einfachen Controlling-Maßnahmen bis hin zu komplexen Managementstrukturen bestehen. Weitere Informationen finden sich im Querschnittsthema Managementsysteme.Energiebeschaffung
Von Zeit zu Zeit ist eine Überprüfung der bestehenden Lieferbedingungen des bzw. der betrieblich relevanten Energieversorger/s unbedingt empfehlenswert. Dabei sollte auch der Wechsel des Energieträgers nicht außer Acht gelassen werden. Seit der Liberalisierung des Energiemarktes hat sich insbesondere die Anzahl der Strom- und Gas-Anbieter vervielfacht und das Angebot ist heute größer und kostengünstiger als noch vor wenigen Jahren. Für die Abnehmer birgt das preisliche Vorteile.
Dank des Wettbewerbs kann der Kunde durch einen Anbieterwechsel aber nicht nur bares Geld sparen, sondern – beim Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter – auch den betrieblichen CO2-Ausstoß signifikant mindern (bis zu 40% Reduzierung). Dabei ist Ökostrom heute selten teurer als konventioneller.
Egal welche Energieform betrachtet wird: Ein Vergleich lohnt sich – und neben hilfreichen Vergleichsportalen im Internet gibt es auch professionelle Hilfe und Beratungseinrichtungen. Beim Vergleich ist jedoch genau auf die Unterschiede bei den einzelnen Tarifen zu achten und beim Wechsel in einen anderen Tarif sind verschiedene Dinge zu berücksichtigen:
Dank des Wettbewerbs kann der Kunde durch einen Anbieterwechsel aber nicht nur bares Geld sparen, sondern – beim Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter – auch den betrieblichen CO2-Ausstoß signifikant mindern (bis zu 40% Reduzierung). Dabei ist Ökostrom heute selten teurer als konventioneller.
Egal welche Energieform betrachtet wird: Ein Vergleich lohnt sich – und neben hilfreichen Vergleichsportalen im Internet gibt es auch professionelle Hilfe und Beratungseinrichtungen. Beim Vergleich ist jedoch genau auf die Unterschiede bei den einzelnen Tarifen zu achten und beim Wechsel in einen anderen Tarif sind verschiedene Dinge zu berücksichtigen:
- So sollte die Vertragslaufzeit beispielsweise nicht allzu lang sein und im Idealfall mit einer Preisgarantie einhergehen, deren Laufzeit die des Vertrages nicht unterschreitet.
- Kurze Kündigungsfristen sind von Vorteil.
- Von Tarifen mit Vorauskasse ist stark abzuraten, da der Verbraucher sein Geld nicht wiederbekommt, sollte der Energieversorger Konkurs anmelden.
- Bei einem leistungspreisabhängigen Stromvertrag ist zu empfehlen, eine Analyse des elektrischen Lastganges erstellen zulassen. Diese sollte wiederholt werden, sobald eine Veränderung der Abnahmestruktur zu vermuten ist. Es ist anzustreben, Tages-, Wochen- und gegebenenfalls Monatslastgänge zu erfassen. Aus einer entsprechenden Analyse lassen sich Möglichkeiten zur Vertragsanpassung, Energierationalisierung und Kostensenkungen entnehmen.
Energiebroker/-makler
zu arbeiten.
Ist die bereits angesprochene erste Analyse des Lastgangs erfolgt, bietet es sich an, diese Lasten im Folgenden auch gezielt zu managen. Einfachste Maßnahme im Bereich des Lastmanagements ist das zeitversetzte Einschalten von großen elektrischen Verbrauchern, um übermäßige Leistungsspitzen – beispielsweise zu Beginn der Arbeitszeit – zu vermeiden (Verteilung auf lastschwächere Zeiten). Diese Maßnahme senkt die maximale Leistungsbereitstellung der Energieversorger drastisch, was erhebliche Auswirkungen auf die Energiekosten hat – ggf. kann dies im Betrieb automatisiert erfolgen und so auch unkompliziert überwacht werden.
Ebenso hat der Einsatz von erneuerbaren Energien, beispielsweise von Photovoltaik einen abmildernden Effekt auf die Lastspitzen, da der selbsterzeugte Strom ein Teil des Bedarfs deckt und somit die zu beziehende Leistung aus dem Netz zu reduzieren hilft.
Ebenso hat der Einsatz von erneuerbaren Energien, beispielsweise von Photovoltaik einen abmildernden Effekt auf die Lastspitzen, da der selbsterzeugte Strom ein Teil des Bedarfs deckt und somit die zu beziehende Leistung aus dem Netz zu reduzieren hilft.
Nutzerverhalten / Mitarbeitermotivation
Je geringer der Automatisierungs- und Steuerungsgrad der Energieinfrastruktur in den Betrieben ist, desto höher kann der Einfluss des bewussten energiesparenden Handelns jedes Einzelnen im Unternehmen sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere in älteren und kleineren Betrieben kaum automatische Regelungen gegeben sind. Hier stellt das Nutzerverhalten einen großen Faktor dar. Es muss für einen sinnvollen Umgang mit Energie ein entsprechendes Bewusstsein bei den Mitarbeitern geschaffen werden. Die gelebte „Energieeffizienz“ ist Teil des Optimierungsprozesses.
Information, Motivation und Schulung der Mitarbeiter haben Einfluss auf das Nutzerverhalten. Es ist wichtig, dass innerhalb und außerhalb des Betriebes deutlich gemacht wird, dass das Unternehmen sich mit den Fragen der effizienten Energienutzung auseinandersetzt und entsprechende Energieeinsparmaßnahmen auch umsetzt. Die Geschäftsleitung sollte hier eine Vorbildfunktion übernehmen. Es gibt viele positive Beispiele, Mitarbeiter in den Prozess der Energieoptimierung einzubeziehen und gleichzeitig deren Motivation wie auch Umsetzungskompetenz zu erhöhen:
Information, Motivation und Schulung der Mitarbeiter haben Einfluss auf das Nutzerverhalten. Es ist wichtig, dass innerhalb und außerhalb des Betriebes deutlich gemacht wird, dass das Unternehmen sich mit den Fragen der effizienten Energienutzung auseinandersetzt und entsprechende Energieeinsparmaßnahmen auch umsetzt. Die Geschäftsleitung sollte hier eine Vorbildfunktion übernehmen. Es gibt viele positive Beispiele, Mitarbeiter in den Prozess der Energieoptimierung einzubeziehen und gleichzeitig deren Motivation wie auch Umsetzungskompetenz zu erhöhen:
- Veranschaulichung der Bedeutung spezifischer Prozesse für die Mitarbeiter
- Transparenz der Energieverbräuche und Kosten gegenüber Mitarbeitern
- Einweisung der Mitarbeiter und Einbeziehung in Optimierungsprozesse
- Umsetzungsmöglichkeiten in die Diskussion in Teamsitzungen einbringen (Erhöhung der Umsetzungsakzeptanz)
- Ggf. erforderliche Schulungsmaßnahmen zur Nutzung neuer Geräte erarbeiten (Erhöhung der Umsetzungskompetenz)
- Stärkung / Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Prozessoptimierung statt Suche nach dem Schuldigen)
- Herausfinden von Reibungsverlusten zwischen Prozessschnittstellen (Optimierung des Gesamtsystems statt einzelner Prozesse)
.
Hilfsmittel & Downloads
- Energiebuch für Handwerksbetriebe
- Praxisleitfaden Mitarbeitermotivation
- Handwerkskammer Dresden: Schriftenreihe-Heft "Controlling im Wirtschaftsbereich Handwerk"
- Energieinstitut der Wirtschaft GmbH: KMU-Initiative zur Energiesteigerung, Begleitstudie: Kennwerte zur Energieeffizienz in KMU, Endbericht, Wien 2010